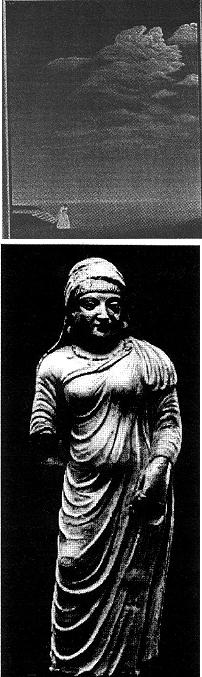 EX ORIENTE LUX
EX ORIENTE LUX
Kunst aus China, Iran, Indien
China und die Hoffnung auf Glück
Die beiden weltberühmten Kunstsammler, Mäzene und
Museumsstifter Irene und Peter Ludwig aus Köln besitzen eine der größten
Kunstsammlungen dieser Erde. Dass ein solcher Schatz nicht nur irdischen Maßstäben
entspringt, zeigt ihre Präsentation ,,China und die Hoffnung auf Glück“
im Museum für Ostasiatische Kunst Köln.
![]() Die Schau des Kölner
Museum für Ostasiatische Kunst, Herbst 2000 bis Frühjahr 2001, trägt
diesen auch für die Gegenwart so Glück verheißenden Titel,
der sich wie ein roter Faden durch die chinesische Kultur mit ihren Paradies-
und Jenseitsvorstellungen zieht, in Malerei, Plastik und Kunsthandwerk. Ihre
Quellen sind die chinesische Naturverehrung, die Religionen des Taoismus,
Buddhismus und des ethischen Konfuzianismus. Eine sehr alte Quelle überliefert
der Dichter Tao Qian (365-427) in seinem legendären ,,Bericht über
die Pfirsichblütenquelle“. Der Wanderer zwischen den Welten gerät
in einen tiefen Wald und entdeckt eine Höhle. Als er sie betritt, erblickt
er in der Tiefe ein Licht, dem er folgt. So gelangt er in ein Paradies, in
dem die Menschen schon seit langer Zeit in Glück und Frieden leben. Dieses
Thema klingt an, z.B. in den blauen Kacheln für die Teezeremonie, die
auch für den Export ins Inselreich Japan bestimmt waren, noch bis in
die Zeit der Qin-Dynastie des ausgehenden 18. Jahrhunderts.
Die Schau des Kölner
Museum für Ostasiatische Kunst, Herbst 2000 bis Frühjahr 2001, trägt
diesen auch für die Gegenwart so Glück verheißenden Titel,
der sich wie ein roter Faden durch die chinesische Kultur mit ihren Paradies-
und Jenseitsvorstellungen zieht, in Malerei, Plastik und Kunsthandwerk. Ihre
Quellen sind die chinesische Naturverehrung, die Religionen des Taoismus,
Buddhismus und des ethischen Konfuzianismus. Eine sehr alte Quelle überliefert
der Dichter Tao Qian (365-427) in seinem legendären ,,Bericht über
die Pfirsichblütenquelle“. Der Wanderer zwischen den Welten gerät
in einen tiefen Wald und entdeckt eine Höhle. Als er sie betritt, erblickt
er in der Tiefe ein Licht, dem er folgt. So gelangt er in ein Paradies, in
dem die Menschen schon seit langer Zeit in Glück und Frieden leben. Dieses
Thema klingt an, z.B. in den blauen Kacheln für die Teezeremonie, die
auch für den Export ins Inselreich Japan bestimmt waren, noch bis in
die Zeit der Qin-Dynastie des ausgehenden 18. Jahrhunderts.
Iran und die Wiederentdeckung des Himmels
Was bei einem Exil-Iraner wie Wahed Khakdan noch verhaltene und nach innen gekehrte Wirklichkeit angesichts einer zerbrochenen Tradition gewesen war, das hellt sich auf in den Gemälden von Pari Ravan, die ihre träumend metaphysischen Bilder Ende 2000 im Museum Baden, Solingen präsentierte. Beiden Künstlern gemeinsam ist die Einsamkeit, die ihre Figuren umgibt. Doch bei der Teheranerin Pari Ravan gesellt sich der Himmel dazu, buchstäblich in ihren Gemälden. Nicht der christliche Himmel ist gemeint; denn die Weite des Heimatlandes Iran, der Traum, der aus den Himmeln alter indoarischer Uberlieferung mit ihrer inspirierten Göttlichkeit spricht, ist gleichsam Zeugnis, an dem sich die Kunst der Pari Ravan misst. Der Orientalist Rudolf Gelpke, der in nie wieder erreichter Poesie altpersische Märchen übersetzt hat, schrieb über die Perser: ,,Es gibt wohl auf Erden kein zweites Volk, das mit seiner abgrundtiefen Skepsis einen so unstillbaren Durst nach dem Absoluten, nach ekstatischer Hingabe und Selbstaufgabe, verbunden hätte.“ Dieses Leitmotiv erklingt auch in der Kunst von Pari Ravan.
Indien und das Erbe Alexanders
Alexander der Große erreichte Nordindien um 300 v.
Chr. Die indischen Stämme leisteten ihm erbitterten Widerstand. Zum einen
hatten sie Angst, er würde ihnen ihre buddhistischen Heiligtümer
zerstören, zum anderen fürchteten sie, versklavt zu werden. Dies
um so mehr, als sie keine Sklaverei in ihrer eigenen Gesellschaft kannten.
![]() Der Siegeszug Alexanders
und damit des Hellenismus eröffnete in Indien eine ungeahnte Entwicklung
von Kunst und Kultur. Die Inder waren keine Barbaren. Hochreligionen wie Buddhismus
und Hinduismus, Zivilisationsformen, die den griechischen ebenbürtig
waren, eine hochentwickelte Philosophie, Architektur, Plastik und Malerei,
kurz: Die indische Kultur feierte heilige Hochzeit mit dem Hellenismus, ging
mit ihm eine Synthese ein.
Der Siegeszug Alexanders
und damit des Hellenismus eröffnete in Indien eine ungeahnte Entwicklung
von Kunst und Kultur. Die Inder waren keine Barbaren. Hochreligionen wie Buddhismus
und Hinduismus, Zivilisationsformen, die den griechischen ebenbürtig
waren, eine hochentwickelte Philosophie, Architektur, Plastik und Malerei,
kurz: Die indische Kultur feierte heilige Hochzeit mit dem Hellenismus, ging
mit ihm eine Synthese ein.
Die Buddhisten kannten bis dahin keine konkrete Darstellung des Buddha, was
die Juden in Alexanders Heerzug begeisterte. Aber Alexander ließ den
Kopf des jungen Buddha von einem griechischen Bildhauer meißeln und
schenkte das vollendete Werk den buddhistischen Mönchen, die sich vor
dem Antlitz des Buddha in den Staub warfen.
![]() Diese Episode, die
Roger Peyrefitte in seiner Alexander-Trilogie überliefert, setzt den
Beginn des hellenistisch-buddhistischen Bildhauerstils, der unter dem Namen
Gandhara bekannt ist. Die Werkstätten von Gandhara, im äußersten
Nordwesten des indischen Subkontinentes, im heutigen Grenzgebiet von Afganistan
und Pakistan gelegen, produzierten noch bis in die Zeit der islamischen Eroberung,
die schließlich das Ende der graeco-buddhistischen Kunst und des Buddhismus
in Indien überhaupt brachte.
Diese Episode, die
Roger Peyrefitte in seiner Alexander-Trilogie überliefert, setzt den
Beginn des hellenistisch-buddhistischen Bildhauerstils, der unter dem Namen
Gandhara bekannt ist. Die Werkstätten von Gandhara, im äußersten
Nordwesten des indischen Subkontinentes, im heutigen Grenzgebiet von Afganistan
und Pakistan gelegen, produzierten noch bis in die Zeit der islamischen Eroberung,
die schließlich das Ende der graeco-buddhistischen Kunst und des Buddhismus
in Indien überhaupt brachte.
![]() Um die Skulpturen
aus Gandhara zu sehen, muss man nicht in die Museen Pakistans fahren. Das
Indische Museum zu Berlin besitzt eine ganze Reihe von ihnen, deren Schönheit
ungebrochen und fürs Publikum stets ein Blickfang ist.
Um die Skulpturen
aus Gandhara zu sehen, muss man nicht in die Museen Pakistans fahren. Das
Indische Museum zu Berlin besitzt eine ganze Reihe von ihnen, deren Schönheit
ungebrochen und fürs Publikum stets ein Blickfang ist.
Thomas Illmaier
Bilder: „Der Blick“ von Pari Ravan; „Weibliche Figur mit Kranz“ aus Gandhara.