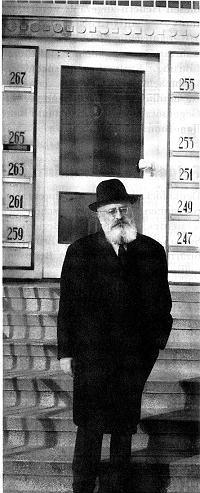 Weinrebs
Liste
Weinrebs
Liste
Kollaboration und Widerstand
Friedrich Weinreb nannte seine Kriegsmemoiren ein „gefährliches
Buch“, das allerdings von sehr viel weniger Menschen gelesen wurde,
als zum Beispiel „Schindlers
Liste“ Menschen in die Kinos zog. Und doch ist das Thema das gleiche:
Jüdischer Widerstand gegen die Nazis war ohne Kollaboration nicht möglich.
![]() Friedrich Weinreb
täuschte die Nazis im großen Stil, indem er während des Zweiten
Weltkrieges die nationalsozialistische Besatzermacht in Holland, namentlich
die Wehrmacht und den Sicherheitsdienst (SD), geschickt gegeneinander ausspielte.
Weinreb, der Ostjude aus Lemberg, brachte es fertig, dass zweimal ein Deportationszug,
der für holländische Juden bestimmt war, leer nach Auschwitz fuhr.
Friedrich Weinreb
täuschte die Nazis im großen Stil, indem er während des Zweiten
Weltkrieges die nationalsozialistische Besatzermacht in Holland, namentlich
die Wehrmacht und den Sicherheitsdienst (SD), geschickt gegeneinander ausspielte.
Weinreb, der Ostjude aus Lemberg, brachte es fertig, dass zweimal ein Deportationszug,
der für holländische Juden bestimmt war, leer nach Auschwitz fuhr.
![]() Dabei begann das
ganze mit einem Zufall. Ein Freund Friedrich Weinrebs hatte sich in Den Haag
auf dem Arbeitsamt eingefunden, weil er einen Aufruf zum sogenannten „Arbeitseinsatz
im Osten“, also den Deportationsbefehl erhalten hatte. Er wollte einen
Aufschub erlangen und wurde abgewiesen. Dabei erlebte er, wie ein anderer
Jude mit demselben Anliegen nicht abgewiesen wurde. Dieser Mann wies einige
Urkunden vor, aus denen hervorging, dass er im neutralen Ausland Devisen für
Deutschland zur Verfügung stellte und dass er aus diesem Grunde wahrscheinlich
die Erlaubnis zur Emigration erhalten würde. Der zuständige Beamte
sah die Dokumente kurz an, nickte „Jawohl, jawohl“ und meinte,
dass in diesem Fall selbstverständlich Aufschub gewährt würde,
damit von den Deutschen zunächst das Emigrationsersuchen geklärt
werden könne. Der Mann wurde für ein halbes Jahr von der Deportation
zurückgestellt, mit Aussicht auf Verlängerung.
Dabei begann das
ganze mit einem Zufall. Ein Freund Friedrich Weinrebs hatte sich in Den Haag
auf dem Arbeitsamt eingefunden, weil er einen Aufruf zum sogenannten „Arbeitseinsatz
im Osten“, also den Deportationsbefehl erhalten hatte. Er wollte einen
Aufschub erlangen und wurde abgewiesen. Dabei erlebte er, wie ein anderer
Jude mit demselben Anliegen nicht abgewiesen wurde. Dieser Mann wies einige
Urkunden vor, aus denen hervorging, dass er im neutralen Ausland Devisen für
Deutschland zur Verfügung stellte und dass er aus diesem Grunde wahrscheinlich
die Erlaubnis zur Emigration erhalten würde. Der zuständige Beamte
sah die Dokumente kurz an, nickte „Jawohl, jawohl“ und meinte,
dass in diesem Fall selbstverständlich Aufschub gewährt würde,
damit von den Deutschen zunächst das Emigrationsersuchen geklärt
werden könne. Der Mann wurde für ein halbes Jahr von der Deportation
zurückgestellt, mit Aussicht auf Verlängerung.
![]() Als Professor Weinreb
diese Geschichte hörte, beschloss er, mit dem Bezirksarbeitsamt zu telefonieren.
„Improvisierend“, wie er in seinen Memoiren schreibt, „das
Gespräch würde sich schon entwickeln.“ Das Gespräch entwickelte
sich in der Tat. Weinrebs resolutes Auftreten machte Eindruck. Er verlangte
sogleich den Chef zu sprechen, der für die Ausweisung von Juden zuständig
sei und stellte sich diesem mit größter Selbstverständlichkeit
als „Dr. Weinreb, Fachmann für Jüdische Emigration“
vor. Seine profunden Kenntnisse in wirtschaftlichen Dingen kamen ihm zugute.
„Der Mann war beeindruckt”, schreibt Weinreb. „Ich erzählte
ihm, dass verschiedene meiner Fälle, die ich bei der Ein- und Ausreisestelle
verträte, in Arbeitslager für Juden verschickt werden sollten, dass
jedoch die Wehrmacht dies nicht wünsche, da diese Personen gegen Devisen
ins Ausland emigrieren sollten.“ Weinreb hatte Erfolg, die von ihm genannten
Personen wurden gesperrt.
Als Professor Weinreb
diese Geschichte hörte, beschloss er, mit dem Bezirksarbeitsamt zu telefonieren.
„Improvisierend“, wie er in seinen Memoiren schreibt, „das
Gespräch würde sich schon entwickeln.“ Das Gespräch entwickelte
sich in der Tat. Weinrebs resolutes Auftreten machte Eindruck. Er verlangte
sogleich den Chef zu sprechen, der für die Ausweisung von Juden zuständig
sei und stellte sich diesem mit größter Selbstverständlichkeit
als „Dr. Weinreb, Fachmann für Jüdische Emigration“
vor. Seine profunden Kenntnisse in wirtschaftlichen Dingen kamen ihm zugute.
„Der Mann war beeindruckt”, schreibt Weinreb. „Ich erzählte
ihm, dass verschiedene meiner Fälle, die ich bei der Ein- und Ausreisestelle
verträte, in Arbeitslager für Juden verschickt werden sollten, dass
jedoch die Wehrmacht dies nicht wünsche, da diese Personen gegen Devisen
ins Ausland emigrieren sollten.“ Weinreb hatte Erfolg, die von ihm genannten
Personen wurden gesperrt.
![]() Bald bekam der Jüdische
Rat Wind von der Sache. Ihm hatten die Deutschen die Aufgabe zugewiesen, die
Deportationstermine einzeln festzulegen. Der Rat erwähnte die Angelegenheit
einmal gegenüber dem Sicherheitsdienst. Eine Wehrmachtsangelegenheit?
Der SD gab nicht gerne seine Desinformiertheit zu, der zuständige SDler
meinte nur: „Weinreb? Devisenemigration? Oh, die ist prima. Wir brauchen
Devisen, bestimmt wird das klappen.“ Langsam entstand eine immer komplexere
Konstruktion. Natürlich musste ein General in Berlin für das ganze
zuständig sein – General Joachim von Schumann. Ein Papiergeneral,
aber er funktionierte.
Bald bekam der Jüdische
Rat Wind von der Sache. Ihm hatten die Deutschen die Aufgabe zugewiesen, die
Deportationstermine einzeln festzulegen. Der Rat erwähnte die Angelegenheit
einmal gegenüber dem Sicherheitsdienst. Eine Wehrmachtsangelegenheit?
Der SD gab nicht gerne seine Desinformiertheit zu, der zuständige SDler
meinte nur: „Weinreb? Devisenemigration? Oh, die ist prima. Wir brauchen
Devisen, bestimmt wird das klappen.“ Langsam entstand eine immer komplexere
Konstruktion. Natürlich musste ein General in Berlin für das ganze
zuständig sein – General Joachim von Schumann. Ein Papiergeneral,
aber er funktionierte.
![]() Weinreb fälschte
Papiere und fingierte einen Brief des Generals. Der SD ließ ihn in Ruhe.
Als 1942 die Deportationen begannen, wurden die Juden nicht mehr aufgerufen,
sondern einfach abgeholt. Weinreb hatte zu dieser Zeit dreißig Menschen
auf seiner Liste. Die Deportierten kamen zunächst ins Auffanglager Westerbork.
Von dort aus erreichten Weinberg Telegramme, Hilferufe. Und Weinreb telegraphierte,
bestätigte Sperrungen – und hatte Erfolg. Die von ihm Genannten
wurden nicht weiterverschickt nach Auschwitz. Niemand wusste damals, was Auschwitz
bedeutete, aber man fühlte, dass es sicherer war zu bleiben.
Weinreb fälschte
Papiere und fingierte einen Brief des Generals. Der SD ließ ihn in Ruhe.
Als 1942 die Deportationen begannen, wurden die Juden nicht mehr aufgerufen,
sondern einfach abgeholt. Weinreb hatte zu dieser Zeit dreißig Menschen
auf seiner Liste. Die Deportierten kamen zunächst ins Auffanglager Westerbork.
Von dort aus erreichten Weinberg Telegramme, Hilferufe. Und Weinreb telegraphierte,
bestätigte Sperrungen – und hatte Erfolg. Die von ihm Genannten
wurden nicht weiterverschickt nach Auschwitz. Niemand wusste damals, was Auschwitz
bedeutete, aber man fühlte, dass es sicherer war zu bleiben.
![]() Nun schwoll die Weinreb-Liste
schnell an. Es ist kaum vorstellbar, was es bedeutete, mit den Nazis dieses
Spiel zu treiben. Weinreb hatte große Angst und musste doch immer ganz
sicher auftreten. Er las in dieser Zeit oft die Psalmen, die Tehillim, die
in Augenblicken der Gefahr zu lesen sind. Die Deutschen waren 1942 auf dem
Höhepunkt ihrer Macht. Sie zum Gegner zu haben, überstieg die Kräfte
eines Einzelnen. Dass es ihm dennoch gelang, Menschen zu retten, erschien
ihm wie ein Wunder. Er riet den Juden, sich nicht auf seine „Sperrungen“
zu verlassen, sondern so schnell wie möglich unterzutauchen, half bei
der Beschaffung von Verstecken, Ausweisen, Geld.
Nun schwoll die Weinreb-Liste
schnell an. Es ist kaum vorstellbar, was es bedeutete, mit den Nazis dieses
Spiel zu treiben. Weinreb hatte große Angst und musste doch immer ganz
sicher auftreten. Er las in dieser Zeit oft die Psalmen, die Tehillim, die
in Augenblicken der Gefahr zu lesen sind. Die Deutschen waren 1942 auf dem
Höhepunkt ihrer Macht. Sie zum Gegner zu haben, überstieg die Kräfte
eines Einzelnen. Dass es ihm dennoch gelang, Menschen zu retten, erschien
ihm wie ein Wunder. Er riet den Juden, sich nicht auf seine „Sperrungen“
zu verlassen, sondern so schnell wie möglich unterzutauchen, half bei
der Beschaffung von Verstecken, Ausweisen, Geld.
![]() Eines Tages wurde
eine Jüdin, die mit seiner Hilfe untergetaucht war, gefasst. Sie gab
an, Ausweise von Dr. Weinreb erhalten zu haben. Er wurde zum Sicherheitsdienst
gebeten, leugnete aber alles. Geistesgegenwärtig bat Weinreb, den General
aus Berlin da herauszuhalten, der könne sich nicht mit kleinen Jüdinnen
abgeben. Vorerst hatte er Erfolg. Aber irgendwann wurde auch dem SD klar,
dass es General von Schumann nicht gab. Weinreb war jedoch so glaubwürdig,
dass man nun annahm, er sei auf eine Verschwörerbande hereingefallen,
die das Reich untergraben und sich bereichern wollte. Der SD schlug Weinreb
vor, die Fronten zu wechseln, und er ging darauf ein.
Eines Tages wurde
eine Jüdin, die mit seiner Hilfe untergetaucht war, gefasst. Sie gab
an, Ausweise von Dr. Weinreb erhalten zu haben. Er wurde zum Sicherheitsdienst
gebeten, leugnete aber alles. Geistesgegenwärtig bat Weinreb, den General
aus Berlin da herauszuhalten, der könne sich nicht mit kleinen Jüdinnen
abgeben. Vorerst hatte er Erfolg. Aber irgendwann wurde auch dem SD klar,
dass es General von Schumann nicht gab. Weinreb war jedoch so glaubwürdig,
dass man nun annahm, er sei auf eine Verschwörerbande hereingefallen,
die das Reich untergraben und sich bereichern wollte. Der SD schlug Weinreb
vor, die Fronten zu wechseln, und er ging darauf ein.
![]() Es gab also weiterhin
Einschreibungen auf der Weinreb-Liste, jetzt legal, mit Wissen des SD. Der
Auftrag des SD an ihn lautete, von Schumann und andere Verdächtige anzulocken
und auszuliefern. 1943 waren ungefähr tausend Juden durch die Weinreb-Liste
für die Deportation gesperrt.
Es gab also weiterhin
Einschreibungen auf der Weinreb-Liste, jetzt legal, mit Wissen des SD. Der
Auftrag des SD an ihn lautete, von Schumann und andere Verdächtige anzulocken
und auszuliefern. 1943 waren ungefähr tausend Juden durch die Weinreb-Liste
für die Deportation gesperrt.
![]() Schließlich
flog die ganze Geschichte auf. Weinreb wurde verhaftet und gefoltert. Man
schlug ihm die Zähne kaputt und brach ihm die Rippen. Er und seine Familie
kamen nach Westerbork ins Übergangslager. Weiterdeportiert wurde er nicht.
Später erfuhr er, dass sich ein anderer aus Dankbarkeit und Anerkennung
für ihn nach Auschwitz hatte deportieren lassen. Nun trat erneut der
SD an Weinreb heran. Der drohende Gesichtsverlust – man wollte nicht
wahrhaben, dass man auf Weinreb alias von Schumann hereingefallen war –
ließ die SDler an von Schumann festhalten. Sie konnten sich einfach
nicht vorstellen, dass Weinreb die ganze Geschichte erfunden hatte, die doch
mit so vielen Menschen funktionierte. Es musste mehr daran sein. Nun wollten
sie Weinreb in den Widerstand einschleusen, um die sogenannte „Schumann-Bande“
zu finden. Weinreb sah eine Chance für neue Rettungsaktionen und zeigte
Entgegenkommen. Er schlug dem SD vor, untergetauchte reiche Juden, holländische
Diamantenhändler, ausfindig zu machen und mitsamt ihren Diamanten gegen
Deutsche, die in Portugal festgehalten wurden,
Schließlich
flog die ganze Geschichte auf. Weinreb wurde verhaftet und gefoltert. Man
schlug ihm die Zähne kaputt und brach ihm die Rippen. Er und seine Familie
kamen nach Westerbork ins Übergangslager. Weiterdeportiert wurde er nicht.
Später erfuhr er, dass sich ein anderer aus Dankbarkeit und Anerkennung
für ihn nach Auschwitz hatte deportieren lassen. Nun trat erneut der
SD an Weinreb heran. Der drohende Gesichtsverlust – man wollte nicht
wahrhaben, dass man auf Weinreb alias von Schumann hereingefallen war –
ließ die SDler an von Schumann festhalten. Sie konnten sich einfach
nicht vorstellen, dass Weinreb die ganze Geschichte erfunden hatte, die doch
mit so vielen Menschen funktionierte. Es musste mehr daran sein. Nun wollten
sie Weinreb in den Widerstand einschleusen, um die sogenannte „Schumann-Bande“
zu finden. Weinreb sah eine Chance für neue Rettungsaktionen und zeigte
Entgegenkommen. Er schlug dem SD vor, untergetauchte reiche Juden, holländische
Diamantenhändler, ausfindig zu machen und mitsamt ihren Diamanten gegen
Deutsche, die in Portugal festgehalten wurden, ![]() einzutauschen.
Um das Vertrauen der Untergetauchten zu erlangen, wurde wieder in Westerbork
eine Liste mit gesperrten Personen aufgestellt, die angeblich zum Austausch
nach Portugal sollten. Weinreb ließ tatsächlich – und dies
mit Hilfe des SD – 1500 Personen sperren. In zwei Fällen mussten
deshalb Deportationszüge leer nach Auschwitz fahren. Dass dieses Spiel
mit dem Teufel nicht lange gut gehen konnte, war ihm klar. 1944 wurde er gewarnt
und konnte im letzten Moment untertauchen. Er und seine Familie erlebten die
Befreiung durch die Kanadier.
einzutauschen.
Um das Vertrauen der Untergetauchten zu erlangen, wurde wieder in Westerbork
eine Liste mit gesperrten Personen aufgestellt, die angeblich zum Austausch
nach Portugal sollten. Weinreb ließ tatsächlich – und dies
mit Hilfe des SD – 1500 Personen sperren. In zwei Fällen mussten
deshalb Deportationszüge leer nach Auschwitz fahren. Dass dieses Spiel
mit dem Teufel nicht lange gut gehen konnte, war ihm klar. 1944 wurde er gewarnt
und konnte im letzten Moment untertauchen. Er und seine Familie erlebten die
Befreiung durch die Kanadier.
![]() Es ist nicht klar,
wieviele Menschen sich durch die Hilfe Friedrich Weinrebs retten und überleben
konnten. Mehrere Hundert waren es auf jeden Fall. Doch seine Rettungsaktionen
spielten sich in der Illegalität ab, im Zwielicht zwischen Widerstand
und Kollaboration. Nach dem Kriege wurde er verhaftet. Da Weinreb sehr viel
wusste, wurde zweimal ein Attentat auf ihn verübt, das er wie durch ein
Wunder überlebte. Die niederländische Justiz warf ihm vor, er habe
Gelder von Juden – die Einschreibung auf die Weinreb-Liste kostete 100
Gulden – für sich (dieser Vorwurf wurde im Urteil fallengelassen)
oder zum Nutzen des SD verwendet; er habe Personen an den SD verraten usw.
1948 wurde Weinreb in letzter Instanz zu sechs Jahren Haft verurteilt. In
der Urteilsbegründung steht der seltsame Satz, „dass es die Rechtsordnung
nicht gestattet, wenn irgendein Mensch im Vertrauen auf eigenes Können
und nach eigenem moralischem Maßstab über Leben und Schicksal anderer
verfügt.“
Es ist nicht klar,
wieviele Menschen sich durch die Hilfe Friedrich Weinrebs retten und überleben
konnten. Mehrere Hundert waren es auf jeden Fall. Doch seine Rettungsaktionen
spielten sich in der Illegalität ab, im Zwielicht zwischen Widerstand
und Kollaboration. Nach dem Kriege wurde er verhaftet. Da Weinreb sehr viel
wusste, wurde zweimal ein Attentat auf ihn verübt, das er wie durch ein
Wunder überlebte. Die niederländische Justiz warf ihm vor, er habe
Gelder von Juden – die Einschreibung auf die Weinreb-Liste kostete 100
Gulden – für sich (dieser Vorwurf wurde im Urteil fallengelassen)
oder zum Nutzen des SD verwendet; er habe Personen an den SD verraten usw.
1948 wurde Weinreb in letzter Instanz zu sechs Jahren Haft verurteilt. In
der Urteilsbegründung steht der seltsame Satz, „dass es die Rechtsordnung
nicht gestattet, wenn irgendein Mensch im Vertrauen auf eigenes Können
und nach eigenem moralischem Maßstab über Leben und Schicksal anderer
verfügt.“
![]() Der Kriegshistoriker
Prof. J. Presser fragt in seinem Werk „Untergang. Die Verfolgung und
Vernichtung des niederländischen Judentums 1940-1945“ zu Recht:
„Welcher Illegale verfügte nicht über Leben und Schicksal
der anderen, im Vertrauen auf eigenes Können und mit eigenem moralischem
Maßstab? Illegale – was machten denn manche Legale anderes?“
Kollaboration und Widerstand ... Jeder Jude, erinnert Presser, war „damals
ein zum Tode Verurteilter“ – ohne Ausnahme. Allein diese Tatsache
hätte den Richtern vor Augen führen müssen, dass der illegale
Krieg gegen die Nazis nach ganz anderen Maßstäben hätte beurteilt
werden müssen. Weinreb selbst hat sich später nie um seine Rehabilitierung
gesorgt. Er war der Meinung, dass in dieser Angelegenheit „irdische
Richter“, wie er sie nannte, gar nicht richten könnten. An deren
Urteil ist er auch nicht zerbrochen; denn Weinreb war ein tief im jüdischen
Glauben verwurzelter Mensch.
Der Kriegshistoriker
Prof. J. Presser fragt in seinem Werk „Untergang. Die Verfolgung und
Vernichtung des niederländischen Judentums 1940-1945“ zu Recht:
„Welcher Illegale verfügte nicht über Leben und Schicksal
der anderen, im Vertrauen auf eigenes Können und mit eigenem moralischem
Maßstab? Illegale – was machten denn manche Legale anderes?“
Kollaboration und Widerstand ... Jeder Jude, erinnert Presser, war „damals
ein zum Tode Verurteilter“ – ohne Ausnahme. Allein diese Tatsache
hätte den Richtern vor Augen führen müssen, dass der illegale
Krieg gegen die Nazis nach ganz anderen Maßstäben hätte beurteilt
werden müssen. Weinreb selbst hat sich später nie um seine Rehabilitierung
gesorgt. Er war der Meinung, dass in dieser Angelegenheit „irdische
Richter“, wie er sie nannte, gar nicht richten könnten. An deren
Urteil ist er auch nicht zerbrochen; denn Weinreb war ein tief im jüdischen
Glauben verwurzelter Mensch.
![]() In den 60er Jahren
erschienen in Holland »Kollaboration und Widerstand», Weinrebs
Kriegsmemoiren (deutsch: Die langen Schatten des Krieges), ausgezeichnet mit
dem Literaturpreis der Stadt Amsterdam. Sie erregten ein solches Aufsehen,
dass Weinreb es vorzog, außer Landes zu gehen. Er starb in der Schweiz
1988 im Alter von 78 Jahren.
In den 60er Jahren
erschienen in Holland »Kollaboration und Widerstand», Weinrebs
Kriegsmemoiren (deutsch: Die langen Schatten des Krieges), ausgezeichnet mit
dem Literaturpreis der Stadt Amsterdam. Sie erregten ein solches Aufsehen,
dass Weinreb es vorzog, außer Landes zu gehen. Er starb in der Schweiz
1988 im Alter von 78 Jahren.
Thomas Illmaier
Factum, 6/1997, S. 42-43.